Die Landesärztekammer Baden-Württemberg führt die Zwei-Faktor-Authentifizerung für den Login auf www.aerztekammer-bw.de bzw. für den Zugriff auf das Dashboard ein.
Falls Sie Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht aktiviert haben, empfehlen wir Ihnen dies möglichst zeitnah vorzunehmen. Die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ab April verpflichtend.
 © Adobe Stock / SB Creative
© Adobe Stock / SB CreativeDer Stabsbereich eHealth bietet nachfolgend eine Auswahl an Informationen aus dem Bereich eHealth, die kontinuierlich aktualisiert werden. Bei Fragen und weiteren Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. - Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Das Anwenderzentrum zur Digitalisierung bei der Landesärztekammer (das ÄBW berichtete in seiner September-Ausgabe) kann seit Anfang Oktober besucht werden. „Es ist wirklich eine großartige Sache, die wir hier unseren Mitgliedern anbieten. Hier können sie die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung unmittelbar erleben“, freut sich Dr. Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, über die Ausstellung in den Räumen der Kammer in Stuttgart-Degerloch.
Terminanfragen können über per E-Mail gestellt werden:
„Leider ist der Konflikt um die Telematikinfrastruktur-Konnektoren in Praxen und Kliniken noch nicht gelöst. Mit oder ohne Konnektor brauchen wir eine funktionierende sichere Anbindung, und das ist lediglich die Voraussetzung für viele andere Anwendungen. Das muss selbstverständlich funktionieren, damit wir die vielen bekannten und neuen Anwendungen einsetzen können. Die Ärztinnen und Ärzte stehen in den Startlöchern“, so Dr. Miller weiter.
Im Mittelpunkt des bundesweit ersten Ärztekammer-Anwenderzentrums steht die Möglichkeit für Ärztinnen und Ärzte, die neuen digitalen Anwendungen im geschützten Raum spielerisch auszuprobieren. Auch Kammer-Vizepräsidentin Agnes Trasselli ist überzeugt: „Auf diesem Wege lassen sich bei den Anwendern Berührungsängste abbauen und mehr Akzeptanz für die Digitalisierung der gesundheitlichen Versorgung erzielen.“
Auch wenn die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits da ist und KIM immer häufiger zum Einsatz kommt, gibt es viele weitere Themen, die auf die Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis zukommen. Das E-Rezept soll zwar anfänglich zunächst in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe eingeführt werden, es wird aber bei Erfüllung der Kriterien in weiteren Bundesländern ausgerollt. „Insgesamt gilt es, den Ärztinnen und Ärzten einen Überblick zu den Möglichkeiten digitaler Anwendungen zu verschaffen und ihnen den Weg zu ebnen. Denn die Digitalisierung wird nicht aufzuhalten sein. Wer nicht ständig auf Dritte angewiesen sein möchte, muss sich mit der Technik beschäftigen.“, betont Kammer-Geschäftsführer Armin Flohr. Mit der Einführung der Telematikinfrastruktur befinde sich die Ärzteschaft erst am Anfang einer Entwicklung, die voraussehbar Geschwindigkeit aufnehmen müsse, damit der Anschluss an andere Länder nicht verlorengehe. „Ganz zu schweigen von Künstlicher Intelligenz, die uns zunehmend unterstützen wird“, ist sich Dr. Miller sicher. Erst kürzlich hatte die Landesärztekammer den Ärztinnen und Ärzten im Südwesten und auch bundesweit durch eine Kooperation mit dem KI-Campus ein breites Fortbildungsangebot zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin eröffnet.
Hier können Sie die Postkarte mit QR-Code zum Auslegen oder Verteilen zu unseren Videoclips auf dieser Seite bestellen.

Eine niedrigschwellige Anleitung für Patienten und medizinisches Personal zur Nutzung der elektronischen Patientenakte.
Bei allen im Anwenderzentrum verfügbaren Anwendungen gewährleistet die Landesärztekammer Produktneutralität, denn für die Auswahl der jeweiligen Komponenten ist ein externes Beratungsunternehmen verantwortlich. Es findet keinerlei Werbung statt. Die Betreuung der Besucher erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesärztekammer, die keinerlei Produktempfehlungen aussprechen. Die Realisierung des Anwenderzentrums erfolgte durch das REACT-EU Projekt DIKOMED-BW, das finanzielle Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt hat.
Die digitale Unterstützung spielt eine immer wichtigere Rolle bei der effizienten Verwaltung und Steuerung von Patienten. Hier sind einige der wichtigsten digitalen Hilfsmittel, die im Anwenderzentrum getestet werden können:
Telefonassistenten: Diese Systeme helfen dabei, Anrufe zu verwalten und Patientenanfragen effizient zu bearbeiten. Sie können Anrufe automatisch weiterleiten, Nachrichten aufnehmen und sogar grundlegende Informationen bereitstellen.
Digitale Dokumentationshilfe: Es gibt digitale Systeme, die Ärzten und medizinischem Personal helfen, Patientengespräche aufzuzeichnen und automatisch in Textform zu bringen. Gesprochene Worte werden in schriftliche Notizen umgewandelt und zusammengefasst. Diese Notizen können in das PVS übertragen werden.
Online-Terminvergabe: Die Möglichkeit, Termine online zu buchen, bietet Patienten Flexibilität und Komfort. Patienten können rund um die Uhr Termine vereinbaren, ändern oder stornieren, ohne die Praxis anrufen zu müssen.
Digitale Anamnese: Digitale Anamnesetools ermöglichen es Patienten, ihre medizinische Vorgeschichte und aktuelle Beschwerden vor dem Arztbesuch online einzugeben. Dies kann während des Termins Zeit sparen. Der Arzt hat zudem alle relevanten Informationen zur Verfügung, um eine fundierte Diagnose zu stellen.
Tool zur Erstellung von Arztbriefen (stationärer Bereich): Außerdem gibt es Systeme, die es ermöglichen, mittels Künstlicher Intelligenz Arztbriefe zu erstellen.
Symptom-Checker: Digitale Tools zur Ersteinschätzung von Krankheitssymptomen. Nutzer und Nutzerinnen werden bei der Selbsteinschätzung unterstützt, indem sie personalisierte Informationen zu möglichen Ursachen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen erhalten. Die ärztliche Diagnose wird nicht ersetzt.
Tool für Handlungsempfehlungen und Lotsen-Funktion: Patientinnen und Patienten werden mithilfe künstlicher Intelligenz nicht nur bei der Ersteinschätzung von Symptomen unterstützt, sie werden darüber hinaus gezielt durch das Gesundheitssystem geleitet. Sie erhalten evidenzbasierte Informationen, passende Versorgungsangebote (z. B. Arztsuche, Telemedizin) und konkrete Handlungsoptionen. Nutzer und Nutzerinnen werden aktiv zu passenden Versorgungsstrukturen navigiert.
Hier lässt sich unter anderem die Kommunikation mittels KIM zwischen zwei Leistungsträgern simulieren. Ferner besteht die Möglichkeit, eine elektronische Patientenakte zu öffnen, zu lesen und zu befüllen.
Ausstattung und Demonstration
2 Praxisarbeitsplätze incl. zwei verschiedene PVS-Systeme
Befüllen und Lesen einer elektronischen Patientenakte (aus Arzt- und Patientenperspektive)
Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Ausstellung des elektronischen Rezepts
Erstellen und Versand eines elektronischen Arztbriefs, eNachricht via KIM
Anlegen und Auslesen eines Notfalldatenmanagements und elektronischen Medikationsplans
Apothekenarbeitsplatz incl. AVS-System
Einlösen eines elektronischen Rezeptes via eGK, E-Rezept-App und Papierausdruck
App zum Online-Check-In für Privatversicherte
Bei den Digitalen Gesundheitsanwendungen, oft auch Apps auf Rezept genannt, besteht die Möglichkeit, sich gezielt mit einzelnen Apps vertraut zu machen. Auf diese Weise erfahren Ärztinnen und Ärzte mehr über die Einsatzmöglichkeiten solcher Apps und wie sie die Patientenversorgung unterstützen können.
Ausstattung und Demonstration
DiGAs mit Demozugängen zum Ausprobieren und Kennenlernen
Wearables
Übersetzungs-App für den Rettungsdienst
Weitere Apps
Neben einem System zur Videosprechstunde bietet das Anwenderzentrum eine Anwendung an, die beispielsweise im Rahmen von Hausbesuchen zum Einsatz kommen kann. Vitalparameter können mithilfe verschiedener digitaler Hilfsmittel und Messgeräte erfasst und direkt an die Praxis übermittelt werden. Über ein Tablet lässt sich außerdem, sofern nötig, eine Videoverbindung zum Hausarzt herstellen. Alle erhobenen Daten können anschließend direkt in das PVS-System der Praxis integriert werden.
Das System zur Unterstützung von Hausbesuchen beinhaltet
Tablet für Datenerhebung und Videotelefonie-System
Digitales Pulsoximeter
Digitales Stethoskop
Digitale Personenwaage
Digitales Blutdruckmessgerät
Digitales EKG
Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Einsatz einer AR-Brille/Datenbrille auszuprobieren, mit der gegebenenfalls ein Experte bei einer Untersuchung oder einer Versorgung zugeschaltet werden kann. Diese wird mittels Spracherkennung bedient, sodass kein Wischen, Klicken, Drücken oder Tippen mehr notwendig ist - die Hände bleiben frei.
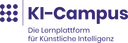
Fokus Künstliche Intelligenz: Landesärztekammer und KI-Campus kooperieren
Kontinuierliches Lernen ist integraler Bestandteil ärztlicher Tätigkeit, um am Puls der Zeit zu bleiben. Umso relevanter ist dies im Feld der Künstlichen Intelligenz (KI), denn solche Zukunftstechnologien spielen auch in der Medizin und der ärztlichen Tätigkeit eine immer wichtigere Rolle. Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg können sich umfänglich und tiefgehend mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzen und an qualitativ hochwertigen, zertifizierten Fortbildungen teilnehmen. Bisher hatten Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg bereits die Möglichkeit, die Grundlagen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in der Medizin kennenzulernen. Zudem können sich die Ärztinnen und Ärzte in den Kursen „Dr. med. KI- Ethik und Daten für Ärztinnen und Ärzte“ und „Dr. med. KI – Ethik und Regulierung für Ärztinnen und Ärzte“ auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Ethik beschäftigen und so ihr Wissen zum Thema KI in der Medizin vertiefen. Im Jahr 2024 hat die Landesärztekammer in Kooperation mit dem KI-Campus erstmalig ein Blended-Learning zum Thema KI in der Medizin angeboten. Diese Fortbildung bestand aus einem Online-Modul und einem Präsenztag. Das erfolgreiche Absolvieren des Online-Moduls war die Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenztag.
Als bundesweit erste Ärztekammer hat die Landesärztekammer Baden-Württemberg eine Kooperation mit dem KI-Campus – der Lernplattform für Künstliche Intelligenz – vereinbart, wodurch entsprechende Lernangebote zur Verfügung stehen, die auch Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland wahrnehmen können.
Hierzu stellt die Landesärztekammer Baden-Württemberg, in Kooperation mit dem KI-Campus – der Lernplattform für Künstliche Intelligenz, ein Fortbildungsformat bereit.
Die Landesärztekammer und der KI-Campus mit seiner Online-Lernplattform (www.ki-campus.org) arbeiten bei der Vermittlung von KI-Lernangeboten und -Kompetenzen im medizinischen Bereich eng zusammen.
Der KI-Campus ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Pilotprojekt. Im Zentrum steht das Anliegen, KI- und Datenkompetenzen durch innovative, digitale Lernangebote auf akademischem Niveau zu stärken und in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Der KI-Campus wird als F&E-Projekt gemeinsam vom Stifterverband, vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), vom Hasso-Plattner-Institut (HPI), von NEOCOSMO und vom mmb Institut entwickelt. Der Stifterverband leitet und koordiniert das Projekt; zahlreiche weitere Institutionen und Organisationen bringen sich als Partner ein, sowohl in der Erstellung von Lernangeboten als auch im Erreichen von unterschiedlichen Zielgruppen.
Bei einem IT-Sicherheitsvorfall kann man sich rund um die Uhr an die kostenlose Hotline 0800-292379347 (0800-CYBERWEHR) wenden.
Das FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe informiert darüber, dass die Cyberwehr Baden-Württemberg auch Einrichtungen aus den Bereichen der medizinischen und pflegerischen Versorgung zur Verfügung steht. Seit Beginn der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine wird von einem erhöhten Gefahrenpotenzial von Cyber-Angriffen ausgegangen, weshalb insbesondere Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Testlabore, Pflegeeinrichtungen und mobile Pflegedienste angesprochen sind.
Bei einem IT-Sicherheitsvorfall kann man sich rund um die Uhr an die kostenlose Hotline 0800-292379347 (0800-CYBERWEHR) wenden. Die Vorfälle werden aufgenommen und von einem IT-Sicherheitsexperten analysiert und kostenlos mögliche sinnvolle Schritte für das weitere Vorgehen geklärt. Ein kostenpflichtiger Besuch vor Ort wird als Zusatzleistung angeboten, damit das Ziel der Arbeitsfähigkeit möglichst schnell wieder hergestellt werden kann.
Die bundesweite Einführung der ePA für alle startet am 29. April 2025
Nachdem die ePA für alle seit Mitte Januar in den drei Testregionen erprobt wurde, stellen die Software-Hersteller ab dem 29.04.25 Software -Updates für ihre Systeme in ganz Deutschland bereit.
Ärztinnen und Ärzte sollen sich bis Oktober auch außerhalb der drei Testregionen mit der Nutzung der ePA vertraut machen. Auch die Software-Hersteller haben in dieser Phase die Chance, ihre Angebote zu verbessern und so für eine massentaugliche Anwendung zu sorgen.
Ab dem dritten Quartal ist die Nutzung verpflichtend. Sanktionen soll es erst ab dem 1. Januar 2026 geben.
Für medizinische Daten von Kindern und Jugendlichen sollen bei der ePA für alle Sonderregeln gelten.
Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollen laut einer demnächst in Kraft tretenden Richtlinie nicht verpflichtet sein, bei unter 15-Jährigen Daten in die ePA für alle zu stellen, sofern diesem Vorgehen erhebliche therapeutische Gründe entgegenstehen.
Gleiches soll gelten, sofern gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohles eines Kindes oder eines Jugendlichen vorliegen und die Befüllung der ePA für alle den wirksamen Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage stellen würde.
Sollten Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten so verfahren, ist dieses in der Behandlungsdokumentation festzuhalten.
ePA für alle (gematik)
Private Krankenversicherungen dürfen ihren Versicherten die ePA ebenfalls anbieten. Erst nachdem der Patient informiert worden ist und die Möglichkeit zum Widerspruch hatte, darf eine ePA für diesen angelegt werden.
Die Akte wird nach denselben Spezifikationen wie bei gesetzlich Versicherten gestaltet. Leistungserbringer werden ausschließlich über die ePA-App berechtigt, da Privatversicherte keine elektronische Gesundheitskarte haben. Einrichtungen erhalten ihren Zugriff also folgendermaßen:
- Privatversicherte benötigen eine Krankenversichertennummer (KVNR) und eine digitale Identität (GesundheitsID), um sich in der ePA-App anzumelden. Für Praxen steht dazu das Verfahren Online Check-in zur Verfügung.
- Bei der erstmaligen Registrierung ist eine Identifikation erforderlich. DieNach der Registrierung ist die Gesundheits ID an ein Smartphone gebunden, welches dann als “vertrauenswürdig” gilt. Dieses Gerät ermöglicht den sicheren Zugang zur ePA.
- Der oder die Privatversicherte sucht in der ePA-App Ihre Einrichtung heraus und erteilt für den gewünschten Zeitraum eine Zugriffsberechtigung.
Welche Unterschiede gibt es zu der ePA für gesetzlich Versicherte?
- Private Krankenversicherungen sind nicht verpflichtet die ePA anzubieten.
- Privatversicherte erteilen Berechtigungen ausschließlich per ePA-App und können die ePA nur über diese nutzen.
- Private Krankenversicherungen stellen keine Abrechnungsdaten in die ePA ein.
- Aus rechtlichen Gründen ist bei Privatversicherten keine Weiterleitung von Daten für Forschungszwecke vorgesehen.
Privatversicherte können ihre persönlichen Daten u.a. die Krankenversichertennummer per Versicherten-App oder ePA sicher via KIM an ihre ausgewählte Praxis schicken lassen.
Das Verfahren heißt „Online Check-in“ und dient vor allem einer einmaligen Übermittlung der Krankenversichertennummer. Diese benötigen Praxen, um E-Rezepte auszustellen und die elektronische Patientenakte (ePA) zu befüllen.
Welche Voraussetzungen müssen in der Praxis für diese Verfahren gegeben sein:
- Anbindung an Telematikinfrastruktur. Empfang von KIM-Nachrichten muss möglich sein.
- Das PVS übernimmt die Daten aus dem Online-Check-in
- Erstellung eines Praxiscodes mit dem QR-Code-Generator der gematik Leistungserbringer / Praxis Check-In. Dieser kann am Empfang oder auf der Website der Praxis für die Privatversicherten bereitgestellt werden.
Wie funktioniert das Verfahren für Versicherte:
- Installation der von der privaten Krankenversicherung bereitgestellten App, die Versicherten den Online Check-in ermöglicht. Dies kann die Versicherten- oder ePA-App sein.
- Einrichtung einer GesundheitsID (digitale Identität) für die Nutzung der App ein.
- Scan des QR-Codes für den Online Check-in mit der Scan-Funktion in der App. Einige Praxen bieten den QR-Code auch auf ihrer Website oder im Terminvereinbarungs-Tool an.
- Zustimmung der Datenübermittlung der Krankenversichertennummer und weiterer Basis-Daten an die Praxis.
- Nachdem die Daten im System der Praxis angekommen sind, ist die Grundlage geschaffen, dass ePA und elektronisches Rezept genutzt werden können.
Patienten können bereits die elektronische Ersatzbescheinigung als Versicherungsnachweis nutzen. Die Anwendung ist zunächst freiwillig. Ab Juli 2025 soll sie für Arztpraxen und Krankenkassen Pflicht werden.
Der Versicherungsnachweis wird über den Kommunikationsdienst KIM automatisiert direkt an die Praxis zugestellt, sodass dieser die Versichertendaten sofort vorliegen. Die Daten können direkt aus dem KIM-Postfach in das PVS übertragen werden.
Der Patient kann über die App die elektronische Ersatzbescheinigung bei seiner Krankenkasse anfragen. Dazu übermittelt er die KIM-Adresse der Praxis, an die seine Krankenkasse die Bescheinigung senden soll. Die Praxis kann den Patienten ihre KIM-Adresse auch als QR-Code zur Verfügung stellen. Die Ersatzbescheinigung wird automatisch generiert und der Praxis per KIM zugestellt.
Praxen können im Auftrag eines Versicherten ebenfalls eine elektronische Ersatzbescheinigung anfordern. Der Datenaustausch via KIM-Dienst findet dann direkt zwischen Praxis und Krankenkasse statt. Diesen Service kann freiwillig angeboten werden.
Die KBV empfiehlt dabei, die Einwilligung des Patienten zum Einholen der elektronischen Ersatzbescheinigung im PVS zu dokumentieren.
KBV - Elektronische Ersatzbescheinigung kann als Versicherungsnachweis ab sofort genutzt werden
Das E-Rezept ist in der Versorgung angekommen, jedoch leider noch nicht für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel.
Zukünftig ist geplant, dass Betäubungsmittel, T-Rezepte und digitale Gesundheitsanwendungen auch über das E-Rezept verordnet werden können.
Langfristig sollen auch Verordnungen für die häusliche Krankenpflege, außerklinische Intensivpflege, Soziotherapien und für Heil- und Hilfsmittel über das E-Rezept erfolgen.
Die Krankenkassen haben ihre ePA-App um die Funktionalität des E-Rezepts erweitert. Somit ist das E-Rezept in die elektronische Patientenakte integriert und Patienten können mittels ihrer ePA E-Rezepte einlösen. und ihre Rezepte verwalten. Die Integration der E-Rezept-Anwendung in die ePA-App soll dem Patienten einen Überblick über bereits eingelöste und noch offene Rezepte geben. Mit Hilfe der integrierten Suchfunktion können Patienten die nächstgelegene stationäre Apotheke finden oder einer Apotheke mit Bringdienst ein E-Rezept zuweisen.
Privatversicherte können E-Rezepte erhalten, sofern ihre Krankenversicherung bereits eine digitale Identität (sog. GesundheitsID) und eine ePA-App mit dem sogenannten „Online Check-in“ und der E-Rezept-Funktion anbietet.
Der elektronische Medikationsplan (eMP) enthält einen strukturierten Überblick darüber, welche Medikamente ein Versicherter aktuell einnimmt. Zudem enthält der eMP medikationsrelevante Informationen, die wichtig sind, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden.
Gesetzlich Versicherte haben seit 2016 Anspruch auf einen Medikationsplan, wenn sie mindestens drei zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verschriebene Arzneimittel über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen anwenden.
Der elektronische Medikationsplan (eMP) kann seit 2020 auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert werden, wenn der Patient dies wünscht und er Zugriff auf die Daten gewährt. Die Nutzung des elektronischen Medikationsplans ist freiwillig.
Seit dem Start der ePA 3.0 im Januar 2025 wurde die elektronische Medikationsliste (eML) eingeführt. Diese ist eine automatisch generierte Liste, die Daten des E-Rezept-Servers übernimmt und die verordnete und von der Apotheke abgegebene Medikation enthält.
Zukünftig (voraussichtlich ab März 2026) werden Versicherte die Möglichkeit haben, den elektronischen Medikationsplan (eMP) in der „elektronischen Patientenakte (ePA) für alle“ speichern zu lassen. Ärzte können Daten aus der Medikationsliste übernehmen, um einen eMP in der ePA zu erstellen.
KIM steht für "Kommunikation im Medizinwesen" und ermöglicht es, medizinische Dokumente elektronisch und sicher über die Telematikinfrastruktur (TI) zu versenden und zu empfangen.
KIM ermöglicht den sicheren elektronischen Datenaustausch zwischen registrierten, authentifizierten Nutzern der Telematikinfrastruktur. Dazu gehören medizinische Einrichtungen wie Praxen, Versorgungszentren, Krankenhäuser, Apotheken ebenso wie deren jeweilige Interessensvertretungen und auch Krankenversicherungen.
KIM funktioniert ähnlich wie ein E-Mail-Programm, jedoch mit integrierter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was einen besonders sicheren Datentransfer gewährleistet. Dies bedeutet, dass nur der Absender und der Empfänger die Inhalte der Nachrichten einsehen können. KIM wird in die Praxisverwaltungssoftware integriert, was die Nutzung besonders einfach und komfortabel macht.
Seit Herbst 2024 gibt es ein Update auf KIM 1.5. KIM 1.5 ermöglicht den sicheren elektronischen Versand und Empfang deutlich größerer Anhänge wie beispielsweise Befunde aus bildgebenden Verfahren. Auch die automatische Zuordnung von Inhalten aus KIM-Nachrichten ist mit der neuen KIM-Version verbessert worden. Zudem wird die Einbindung des KIM-Mailclients in das Praxisverwaltungssystem erleichtert.
Das nächste Update (KIM 1.5.3) soll erleichtern, im Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur zu erkennen, welche Anwendungen von der Empfängeradresse genutzt und verarbeitet werden können.
Folgende Dokumente können per KIM verschickt werden:
• Befunde (Labordaten, Röntgenbilder)
• Arztbriefe
• Heil- und Kostenpläne
• Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
• Abrechnungen
Digitale Identitäten im Gesundheitswesen sollen künftig als Alternative zu Gesundheitskarten (eGK) eingesetzt werden und bieten Versicherten einen freiwilligen kartenlosen Zugang zu allen Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI). Digitale Identitäten ermöglichen es Versicherten, sich über ihr Smartphone in Apps wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte einzuloggen. Krankenkassen stellen ihren Versicherten bereits seit dem 1.1.2024 auf Wunsch eine digitale Identität in Form einer GesundheitsID zur Verfügung.
Zum Schutz der digitalen Identität vor Missbrauch, ist die gängige 2-Faktor-Authentifizierung vorgesehen. Die GesundheitsID soll zyklisch durch eine Anmeldung über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit PIN bestätigt werden.
Ab 2026 brauchen Patientinnen und Patienten keine eGK mehr als Versicherungsnachweis in der Praxis, sondern können sich mit ihrer digitalen Identität ausweisen.
Die Roadmap für den TI-Messenger (TI-M) sieht drei verschiedene Produktvarianten vor: TI-Messenger Pro, TI-Messenger ePA und TI-Messenger Connect:
- TI-M Pro ermöglicht eine sichere, anbieter- und sektorenübergreifende Chat-Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Zukünftig werden auch Krankenkassen über einen TI-Messenger Pro kommunizieren können. Die Spezifikation ist bereits veröffentlicht und seit April 2024 gibt es erste Anbieter- und Produktzulassungen.
- TI-M ePA wird die Kommunikation zwischen Versicherten und Krankenkassen sowie den Versicherten und den Leistungserbringern ermöglichen.
- Spezifikation: Q2/2024
- verfügbar: Q3/2025
- Mit TI-M Connect können Versicherte einen TI-Messenger über Anwendungen nutzen, die sie bereits kennen. TI-M wird als Kommunikationsanwendung in DiGA, Patientenportale oder Videosprechstunden-Apps integriert werden.
- Spezifikation: Q2/2024
- verfügbar: Q3/2025
Da alle Anbieter untereinander kommunizieren können, ist es unerheblich welcher Anbieter verwendet wird.
Über ein TI-Gateway wird die Verbindung eines Leistungserbringers an einen High-Speed-Konnektor hergestellt, sofern dieser nicht vor Ort ist. High-Speed-Konnektoren stellen die neue Version von Konnektoren dar, die die Einbox-Konnektoren ablösen werden. In der ersten Ausbaustufe werden die High-Speed Konnektoren von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen großen Einrichtungen eingesetzt. In einer weiteren Ausbaustufe stehen die High-Speed-Konnektoren in Rechenzentren auch für Praxen zur Verfügung.
Bei der Nutzung des TI-Gateways verbinden sich die Leistungserbringer über eine sichere VPN-Verbindung mit einem Rechenzentrum eines zertifizierten Anbieters. Über das Rechenzentrum wird dann ein Zugang zur TI hergestellt.
Um das TI-Gateway zu nutzen, muss ein Vertrag mit einem von der gematik zertifizierten TI-Gateway-Anbieter abgeschlossen werden. Leistungserbringer erhalten von Ihrem Anbieter einen VPN-Zugang, über den Sie sich in ein Rechenzentrum einwählen können. Dort betreibt der Anbieter ein Zugangsmodul und einen High-Speed-Konnektor. Der Highspeed-Konnektor ist von der gematik geprüft und zugelassen und stellt den sicheren Zugang zur TI her.
Updates und Wartungsarbeiten an den Konnektoren erfolgen zentral und nicht mehr vor Ort.
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), welches seit dem 19.12.2019 in Kraft ist, wurde u.a. ein Leistungsanspruch der Versicherten auf digitale Gesundheitsanwendungen ("DiGA") geschaffen.
Demnach können Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen und Patienten sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach § 33a SGB V, auch bekannt als „Apps auf Rezept“, verschreiben.
DiGA sind dazu bestimmt, „bei den Versicherten […] die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen zu unterstützen“.
Bevor eine App verschrieben werden kann, muss Sie beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in das DiGA-Verzeichnis nach § 139e SGB V aufgenommen werden und als Medizinprodukt anerkannt sein.
Weitere Informationen zum Bewertungsverfahren finden Sie auf der Webseite des BfArM.
DiGA können die ärztliche Arbeit bei Diagnose und Therapie sinnvoll ergänzen, sofern sie in
die medizinische Versorgung wirkungsvoll integriert werden können. Der Vorstand der Bundesärztekammer hat im März 2023 dazu ein Positionspapier verabschiedet:
Derzeit werden die digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) noch auf Muster 16 verordnet. Zukünftig sollen sie aber auch als E-Rezept verordnet werden.
Praxen, die digitale Gesundheitsanwendungen mit ihrer Praxissoftware verordnen, müssen dafür ein zertifiziertes Produkt verwenden.
Von Oktober 2020 bis Dezember 2024 wurden rund 870.000 DiGA-Freischaltcodes eingelöst.
Im Dezember 2024 wurde ein Referentenentwurf des BMG zur „Zweiten Verordnung zur Änderung der Digitale Gesundheitsanwendungen-Verordnung“ veröffentlicht. Das BMG möchte verschiedene Vorgaben konkretisieren und neue Regelungen einführen:
von den Herstellern soll ein Nachweis „zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit“ erbracht werden.
Es soll die Möglichkeit geben, dass auch DiGA in das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen aufgenommen werden können, die trägerübergreifend zum Einsatz in der medizinischen Rehabilitation bestimmt sind.
DiGA können als Leistungen nach dem Sechsten Buch erbracht werden, wenn diese nach Erfüllung zusätzlicher Anforderungen an die Evidenz in dem Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen gelistet sind
Definition von Anforderungen für eine schrittweise Umsetzung à Für die Hersteller wird damit Vorhersehbarkeit und Klarheit hinsichtlich der AbEM geschaffen. AbEM ist eine anwendungsbegleitende Erfolgsmessung, die durch das BfArM geprüft wird.
Anpassungen an die KI-Verordnung der Europäischen Union und in Bezug auf das Prüfverfahren beim BfArM. Dieses soll demnächst eine kurze Begründung für eine Streichung von Anwendungen aus dem DiGA-Verzeichnis veröffentlichen müssen
Das Notfalldatenmanagement wird gegenwärtig auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert (bis max. Ende 2029) und besteht aus zwei Elementen:
- Dem Notfalldatensatz mit notfallrelevanten, medizinischen Informationen zum Patienten
- Einem Datensatz mit Hinweisen zu persönlichen Erklärungen des Patienten
Zukünftig ist geplant, dass das NFDM zusätzlich als online Anwendung bereitgestellt wird, wobei der Datensatz mit den persönlichen Erklärungen dann nur noch in der elektronischen Patientenakte abgelegt wird. Das NFDM wird als online Anwendung in die elektronische Patientenakte (ePA) aufgenommen und wird somit in die elektronische Patientenkurzakte (ePKA) umgewandelt. Die ePKA können Versicherte auch im EU-Ausland als internationale Patientenkurzakte (Patient Summary) nutzen.
Privatärztinnen und -ärzte haben ab diesem Jahr die Möglichkeit, sich an die Telematikinfrastruktur (TI) anzuschließen.
Für einen Teil dieser Ärztinnen und Ärzte wird es sogar notwendig sein, sich zeitnah an die TI anzuschließen. Der Grund dafür ist der Start des Regelbetriebs des Implantateregisters Deutschland (IRD). Das Implantateregistergesetz gibt vor, dass Meldungen von Brustimplantaten ab 01.07.2024 über einen TI-Anschluss erfolgen müssen. Ab 01.01.2025 wird diese Meldepflicht auf Hüft- und Knieimplantate erweitert.
Auch unabhängig von einer Verpflichtung wird der Anschluss an die TI für Privatärztinnen und -ärzte voraussichtlich alternativlos sein, da mittels der TI beispielsweise das Verordnen von elektronischen Rezepten, der Zugriff auf die elektronische Patientenakte und die Notfalldaten von Versicherten sowie die Teilnahme am sicheren Übermittlungsverfahren KIM ermöglicht wird.
Für den Zugang zur TI werden unter anderem benötigt:
- Ein elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)
- Eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer, welche die Mitgliedschaft in der Kammer und zugleich die privatärztliche Praxistätigkeit in Niederlassung bestätigt.
- Eine SMC-B Institutionskarte (Security Module Card – Typ B)
Der eHBA, die Bescheinigung der Kammermitgliedschaft und die Bestätigung der Praxistätigkeit in Niederlassung sind Voraussetzungen für den Erhalt einer SMC-B.
Die Bescheinigung können sich Privatärztinnen und -ärzte entweder selbst auf dieser Internetseite der Landesärztekammer über das Dashboard in den Stammdaten hinter dem LOGIN herunterladen oder beim Meldewesen ihrer Bezirksärztekammer anfordern.
Bei Fragen zum eHBA und zur Bescheinigung:
0711 76989-2698
Die gematik ist verantwortlich für die Ausgabe der Institutionskarten SMC-B an Praxen privatärztlich tätiger Ärztinnen und Ärzte. Für den Antragsprozess, die Produktion und die Auslieferung der Karten hat die gematik die Bundesdruckerei/D-TRUST beauftragt.
Weitere Informationen:


 © gematik
© gematik